John Banville: Die See
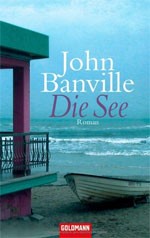
Autorin/Autor: Banville, John
Genre:
Buchbesprechung verfasst von: Felix Haas
„They Departed, the gods, on the day of the strange tide.“ Warum lässt ein Autor seinen Roman so anfangen? Welche Eindrücke und Erwartungen weckt er damit bei uns, seinen Lesern? Während wir von diesem ersten Satz zum zweiten springen, kommen uns zwei Möglichkeiten in den Sinn: Entweder schreibt hier jemand, der wirklich ein Meister seiner Kunst ist, oder jemand, der fest davon überzeugt ist ein solcher zu sein. Für Banville jedoch scheint beides zu gelten.
Die See, Banvilles bereits vierzehnter Roman, der 2005 erschien, und im selben Jahr den prestigeträchtigen englischen Man Booker Prize gewann, ist ein vor allem linguistisch sehr anspruchsvoll angelegtes Projekt, das jedoch immer wieder über die Selbstüberzeugung seines Autors stolpert.
Das Buch ist die Erzählung seines Protagonisten Max Morden, einem Kunsthistoriker Mitte fünfzig, der seine Tage alleine an der Irischen See verbringt um den Tod seiner Frau zu verarbeiten, oder, wie es von Zeiten scheint, vor ihm zu fliehen: „Being here is just a way of not being anywhere.” Max‘ tagebuchartige Ausführungen fliessen frei zwischen drei Erzählebenen: Dem Jetzt ihres Erzählers, der Zeit um die Erkrankung und des relativ schnellen Todes seiner Frau Anna, sowie Jugenderinnerungen, in denen uns Max durch einen Sommer führt, in dem er ein erstes Mal als etwa Zehnjähriger im selben Dorf an der See einige Sommerwochen mit seinen Eltern verbracht hatte.
Schnell wird klar, dass die eigentliche Handlung des Romans nicht im Jetzt liegt, sondern in jenen langen Wochen seiner Kindheit, in denen der junge Max die Bekanntschaft der Graces macht, einer Familie des gehobenen Mittelstandes. Max ist sowohl von dem bescheidenen Wohlstand der Graces eingenommen, als auch von den Frauen der Familie. Zunächst sind es die üppigen Formen von Mrs Grace die ihn anziehen, doch bald schon muss er feststellen, dass sich seine Faszination von dieser abgewendet hat und auf ihre Tochter Chloe übergegangen ist. Die Grace Kinder, Chloe und Myles, haben eine merkwürdig starke Verbindung zueinander, was nicht nur darauf zurückzuführen ist, dass sie Zwillinge sind, sondern auch darauf, dass der stumme Myles oft nur mit und durch Chloe kommuniziert und so praktisch allgegenwärtig und bis zuletzt stets stiller Teil der zwischen Max und seiner Schwester aufkeimenden Beziehung ist.
Umso weiter uns Banville an das Jetzt des Erzählers heranführt, desto mehr kehrt sich sein Auge ins Innere seines Protagonisten und verfällt in einen stream of concious artigen Erzählstil, von dem äussere Handlung zeitweise völlig abfällt und der nur noch Erinnerungen, Gedanken und Gefühle zulässt. Was nach einem interessanten Versuch klingt, gelingt jedoch nicht immer. Zu oft fühlt sich der Leser alleingelassen zwischen den Zeiten und Erzählebenen, in einem Strom, der nicht nur ein Strom des Bewusstseins ist, sondern allzu häufig auch ein Strom von Sätzen, die etwas zu sehr ins Prätentiöse neigen. So beschreibt er zum Beispiel einen Sturm als „spectacular dispay of Valhallan petulance“ oder vergleicht auch schon einmal die Braue seiner sterbenden Frau mit einem Straussenei. Das einzige Mal, als seine Sprache vulgär wird, wirkt sie gewollt, eher künstlich als natürlich und erinnert uns an Situationen unserer Kindheit, als ein Lehrer oder unser Vater uns beweisen wollten, dass auch sie unsere Sprache sprechen. Banville ist vielleicht dann am besten, wenn er einfach bleibt. Dann gelingen ihm auch Sätze wie dieser: „We did our best, Anna and I. We forgave each other for all we were not.“
Taste, Geschmack, ist nicht nur der Mut sich auf diesen Drahtseilakt einzulassen, auf dessen einer Seite Kitsch und auf dessen anderer Prätention liegt, sondern vor allem, dass man diesen auch zu meistern weiss. Banville mag nicht ins Fallen geraten, doch scheint er an der einen oder anderen Stelle doch stark zu wanken und beweist nur ganz selten die Leichtigkeit mit der sich etwa eine Virginia Woolf auf diesem Seil bewegt.
Jedoch entlohnt uns der Schlussteil des Buches ein Stück weit. Wenn die einzelnen Erzählebenen auch nicht wirklich konvergieren, so nähern sie sich doch an und schneiden sich schliesslich im Jetzt des Erzählers. Und so finden wir auf den letzten Seiten des Romans Tod nicht nur in Jugend und Kindheit, sondern durch die See auch in der Natur selbst, werden so konfrontiert mit der Vergänglichkeit alles Lebenden, und folgen dem Autor schliesslich in der Erkenntnis: „What are living beings, compared to the enduring intensity of mere things?”
Doch noch vor dem sich Schneiden der Geschichtsstränge, nehmen Max‘ Kindheitserzählungen eine rasante und wenig zu erwartende Wendung, die seinen Aufenthalt an der See als Erwachsener nicht als Überwindungsversuch eines, sondern zweier Traumata entlarvt. Diese letzten Teile des Buches sind auch deshalb stärker als sein Rest, weil Banville uns mehr Handlung schenkt und so sich selbst weniger Plätz lässt in Beobachtungs- und Erinnerungsflüsse zu verfallen, welche ihm nicht immer gelingen.
Von der ersten, bis zur letzten Seite, ist Die See ein Buch über Verlust, Trauer und den Versuch seiner Überwindung. Mit diesen Themen ist Die See ein stiller Roman, ein trauriger, ein melancholischer. Das heisst, das hätte er sein können, vielleicht sein müssen, doch wird diese stille Melancholie immer wieder von der zu lauten Prosa ihres Autors durchbrochen. Allzu oft folgt einem wunderbar gelungenen, meisterhaft konstruierten Satz ein zweiter, zu hochtrabender, zu gewollt kunstvoller. Und so steht sich Banvilles Sprache am Ende immer wieder selbst im Weg.
Es steht ausser Frage, dass Banville ein überaus fähiger Autor und Stilist ist, doch scheint er sich dessen allzu bewusst. Noch expliziter als in seinem Roman, mag dies in der Dankesrede werden, die er zum Erhalten des Man Booker Prizes hielt, worin er seine Freude darüber zum Ausdruck brachte, dass mit seinem Buch ein „work of art“ (ein Kunstwerk) den Preis zugesprochen bekommen habe.
Ist Die See am Ende ein schlechter Roman? Sicher nicht. Doch bleibt er eben immer wieder weit hinter den Massstäben zurück, die er sich selber setzt und ist so schlussendlich ein nicht vollkommen geglückter Versuch wirklich grosser Literatur.

