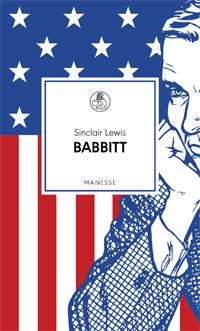Sinclair Lewis: Babbitt
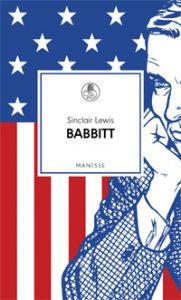
Autorin/Autor: Lewis, Sinclair
Genre:
Buchbesprechung verfasst von: Andreas
Diesen Roman heute, beinahe 100 Jahre nach der Erstveröffentlichung, zu lesen hat zwei ungemeine Vorteile: 1. kann man mit Erstaunen und Interesse einen Einblick in das tägliche Leben der 1920er-Jahre nehmen und 2. dabei feststellen, dass sich vieles überhaupt nicht geändert hat. Denn abgesehen von all den technischen Spielereien und Hilfsmitteln, von denen wir heute natürlich viel mehr haben, haben sich die Menschen selbst, ihre Ansichten, ihre Vorlieben und Abneigungen kaum geändert.
„Babbitt“ ist somit nicht nur ein Roman über einen Mann in mittleren Jahren sondern auch eine Reportage aus der Vergangenheit.
Wir befinden uns im Jahr 1920 in der fiktiven Stadt Zenith: ein paar hunderttausend Einwohner, Geschäftszentrum mit Hochhäusern im Zentrum, Vorstädte runderherum; typisch amerikanische Kleinstadt. Typisch auch die Babbitts: Vater George F., 46, Immobilienmakler; Myra, seine Frau und die drei Kinder. Sie alle wohnen in einem typischen Vorstadthaus mit typischer Einrichtung und davor steht mit dem Auto das in dieser Zeit herausragende Statussymbol.
Seinen Protagonisten begegnet Sinclair Lewis meistens mit Ironie, gelegentlich überschüttet er sie auch mit Spott. So wie sie sich benehmen, wie sie sich klischeehaft gegenüber anderen verhalten, wie sie meinen, diese oder jene Attitüde würde sie zu einem Mitglied der „besseren Gesellschaft“ machen und überhaupt wären sie so etwas wie die Spitze der Evolution. Wie sie dann doch nur ganz biedere Zeitgenossen sind, die sich mit einer Mischung aus Spießertum und Prüderie ihre eigene kleine Welt erschaffen, banal, monoton, gewöhnlich. Würden sie ehrlich zu sich selbst sein, müssten das alles als völlig geistlos anerkennen; tun sie aber nicht, sondern versuchen bei jeder Gelegheit sich in den Vordergrund zu spielen, besser dazustehen, wichtiger zu sein.
Babbitt und seine Freunde und Bekannten, allesamt Mitglieder der dieser selbst ernannten besseren Gesellschaft, blicken nicht auch nur einen Millimeter über ihren eigenen Horizont hinaus, Meinungen und Ansichten wechseln mit den Umständen und werden folgerichtig jedes Mal erneut als Ultima Ratio betrachtet; bis zum nächsten Wechsel der Umstände.
Was außerhalb der Geschäftshäuser, der Büros, der Klubs geschieht, das ist die Welt der Unbekannten, der Anderen. Aus denen lässt sich zwar jederzeit Personal und Arbeitskraft rekrutieren. Die solcherart mit Wohltat überschütteten sollen sich dann gefälligst überwältig von der Gnade zeigen, eine Beschäftigung gefunden zu haben; sollen sich mit dem begnügen, was ihnen aus der „besseren Gesellschaft“ an Zuwendungen gewährt wird. Und wer sich erdreistet, Forderungen nach mehr Gehalt und besseren Bedingungen zu stellen, den wünscht man sich in Babbitts Kreisen dann auch gleich einmal an den Galgen.
So hält Sinclair Lewis seiner Hauptfigur (und zugleich allen Babbitts dieser Welt) mehrmals während dessen Tagesablauf den Spiegel vor: wie wenig sich seine Selbsteinschätzung als einem fortschrittlichen, menschenfreundlichen Zeitgenossen mit seinem alltäglichen Handeln in Gleichklang bringen lässt.
Und immer wieder der Blick auf die Welt des George Babbitt: eine Welt, in der die technischen Errungenschaften schier kindliche Freude und standesbewusste Besitzwünsche erzeugen. Der neue Zigarrenanzünder, alle diese elektrischen Geräte, der Wagen, der dem Vergleich zum Wagen des Nachbarn standhalten muss. Und das weitet sich zu Standesdünkel aus – wir (die Babbitts der Welt) die besseren, die etwas erreicht haben und die anderen. Beinahe so, als ob diese anderen einer ganz anderen Menschengattung angehörten, über deren Vorlieben, Lebensweisen und Gedankengänge man nur so spekulieren könne, aber in Wahrheit nichts wisse, weil sie so fremdartig sind.
Dann die Sprache; wie die Zeitungen voll von Anzeigen sind, in denen für alles und jedes die bahnbrechende Lösung angepriesen wird, wie alles das formuliert wird, wie das von diesen ganzen neuen Heils- und Reichtumsversprechen geblendete Publikum nur noch staunt, was alles möglich ist, wie Babbitt seine Briefe schreibt: das hat immer etwas von Marktschreierei und oft kann man sich dazu alte, emaillierte Werbetafeln vorstellen, mit kunstvoll gestalteten Motiven, mit dem Versprechen, nur das Beste zum besten Preis zu bieten; oder eben einen Marktschreier, der, oben auf seinem Verkaufswagen thronend, die Menschen einzufangen versucht.
Einiges blieb bis heute – so wie der große neue Wagen, der trotz leerer Garage draußen vor der Türe stehen bleibt, damit die Nachbarn eine neidvollen Blick darauf werfen können. Und natürlich auch dieser Gruppenzwang, immer das Neueste besitzen zu müssen, ungeachtet von dessen Nutzen (was ja heutzutage u.a. die Basis des Geschäftsmodelles von Apple mit dem iPhone ist – viele weitere Beispiele kennen wir alle). Das Marktschreierische blieb auch – nur hat es sich von der Werbung oftmals in die Politik verlagert.
Der Roman entwickelt sich aus einer oft amüsanten Satire zu einem Roman über einen Menschen, der sich im andauernden Zweifel über die Ausrichtung seines Lebens befindet. Babbitt möchte einerseits seinem Umfeld gefallen, empfindet aber andererseits auch zunehmende Unzufriedenheit mit seiner Konformität. Obwohl diese Unzufriedenheit sich zu einem nur sehr bescheidenem – gemessen an heutigen Maßstäben praktisch nicht erwähnenswerten – „Protestverhalten“ entwickelt, so reicht das in jener Zeit doch, um Babbitts sozialen und gesellschaftlichen Kontakte und Erfolge ganz enorm zu gefährden.
Nur gelegentlich schwächt sich meine Begeisterung. Dann, wenn Sinclair Lewis im – von mir angenommenen – Vorhaben, möglichst viele Klischees über biedere Vorstandmenschen einzubringen, ein wenig zu viel des Guten schreibt und damit einige Längen in die Erzählung geraten. Nicht weiter schlimm, wenn man dann an geeigneten Stellen etwas schneller weiter blättert.
Parallelen zwischen Lewis‘ Roman und unserer Zeit wird jede Leserin/jeder Lesen finden – welche, das hängt wohl vom eigenen Lebensumfeld ab. In jedem Fall, da bin ich sicher, gibt es für die meisten einige Abschnitte, deren Vorgänge irritierend detailliert an eigene Erlebnisse oder Ereignisse unserer Gegenwart erinnern. Wie ein Spiegel eben …