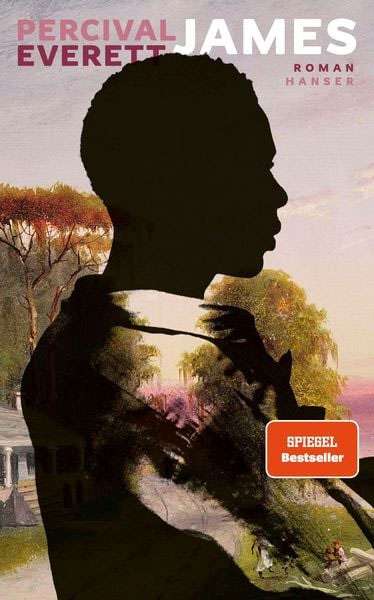Percival Everett: James

Autorin/Autor: Everett, Percival
Genre:
Buchbesprechung verfasst von: Andreas
Online bestellen:

James, ist ein erwachsener Mann mit Familie. Was ihn von den freien Männern seiner Zeit unterscheidet, das ist seine Hautfarbe, denn er ist schwarz und er ist Sklave.
Als er erfährt, dass er verkauft werden soll, nur er alleine, ohne seine Frau und seine Tochter, fasst James den Entschluss, zu fliehen. Es gibt in den Südstaaten aber nur eine Sache, die schlimmer ist, als Sklave zu sein: ein entflohener Sklave zu sein. Wird er gefasst, sind ihm grausame Folter und der Tod gewiss.
Im ersten Versteck, das er findet, trifft James auf Huckleberry Finn. Mit dem kleinen, weißen Jungen verbindet ihn schon seit längerer Zeit eine Art von Freundschaft. Huck ist geflohen, weil er die Brutalität seines Vaters nicht mehr ertragen wollte, und hat dabei etwas getan, das James’ Flucht doppelt gefährlich macht. Huck hat vorgetäuscht, ermordet worden zu sein und die Weißen werden sicher keinen Moment daran zweifeln, dass James der Mörder ist.
Zwei auf der Flucht entlang des Mississippi. Es ist der Ausgangspunkt für eine abenteuerliche und gefährliche Reise auf den Spuren Mark Twains. Nur tritt jetzt James an die Stelle von Tom Sawyer, was die Perspektive der Handlung verändert und das Amerika jener Zeit aus der Sicht eines Schwarzen erzählt, der die Welt als Sklave und Unfreier erleben muss.
Die oben und die unten
Es gab eine Zeit (das ging bis in die 1950er-Jahre, wenn ich mich nicht irre), da wurden Schwarze in Hollywood-Filmen meistens als dümmlich, verbunden mit einer dem entsprechenden simplen Ausdrucksweise in kindlicher Sprache, dargestellt. Die deutsche Synchronisation übernahm das unkritisch. Das entsprach in der Originalfassung dem in den USA weit verbreiteten und als beinahe selbstverständlich gelebten Rassismus und andererseits bei der Synchronisation dem in Europa dazu völlig unkritischen Verhalten.
Percival Everett, zeigt in seinem Buch auch, wenn wahrscheinlich auch nicht mit vordergründiger Absicht, wie irgendjemand überhaupt auf die aberwitzige Idee kommen konnte, Schwarze auf der Leinwand derart abwertend zu zeigen.
Denn James, der Ich-Erzähler, schwarz und Sklave, hat aus Selbstschutz gelernt, den Weißen gegenüber stets seinen Charakter zu verbergen und ihnen das vorzuspielen, was sie von einem Schwarzen erwarten: ungebildet zu sein, des Lesens nicht mächtig, mit einem sehr beschränkten Wortschatz und ahnungslos gegenüber dem Wissen und den Wissenschaften. So bedient sich James eben auch einer sehr reduzierten Sprache und stellt sich dumm, wenn ein Weißer etwas von ihm will. Besser, man gibt ihm immer das Gefühl, überlegen zu sein. Denn wenn es einem Weißen gefällt, kann er seine Sklaven verkaufen, misshandeln, bestrafen, ermorden, ohne je irgendwelche Konsequenzen befürchten zu müssen, ja ohne irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden, dass Sklaven überhaupt Menschen wären.
Wir sind Sklaven. Wir sind nirgendwo. Ein freier Mensch kann sein, wo er will. Der einzige Ort, wo wir jemals sein können, ist in der Sklaverei.
S. 237
Dass die Weißen dann auch noch religiöse Gründe für eine vermeintlich gottgewollte Rangordnung nach Hautfarbe geltend machten, ist an Verlogenheit nicht zu überbieten.
Diesen „Slang“ der Sklaven zu lesen ist anfangs etwas mühevoll; weil er aber sehr lautmalerisch geschrieben ist, lässt er sich, laut gesprochen, gut verstehen und dann gewöhnt man sich auch beim Lesen schnell daran (siehe dazu auch das Nachwort des Übersetzers).
Nur wenn sie unter sich sind, sind die Sklaven wirklich Menschen. Wenn sie die Maske ablegen, die sie für die Weißen aufsetzen, dann blitzt aus ihren Unterhaltungen bisweilen tiefgründiger Humor hervor; dann lässt Percival Everett sie ihre ganze Verachtung gegenüber jenen Menschen zeigen, die sich anmaßen, andere als Sklaven zu halten.
Nachlesen, wie es damals war
Wenn zu lesen ist, wie abwertend und niederträchtige die Weißen jeden Schwarzen behandeln, dem sie auch nur zufällig begegnen, dann ist es beinahe unerträglich zu wissen, dass es tatsächlich so war. Dann wieder gibt es auch witzige Szenen, wenn James und seine Leidensgenossen wie automatisch ihr Verhalten ändern, abhängig sie unter sich, oder ob Weiße in der Nähe sind.
Percival Everett beschreibt auch einen Aspekt der Zeit der Sklaverei in den Vereinigten Staaten, der mitunter vergessen wird: Sklavenhaltung gab es zwar nur in den Südstaaten, aber auch im Rest des Landes fand man genügend Menschen, die, wenn sie schon selbst keine Sklaven hielten, dennoch überzeugt waren, dass Schwarze eine „minderwertige Rasse“ sind. Dass dieses Gedankengut bis heute nicht verschwunden ist, ist unerträgliche Realität.
Das alles ist nicht mit erhobenem Zeigefinger niedergeschrieben, wenn auch die Brutalität und die aus nichtigen Gründen geübte Lynchjustiz ihren Platz in diesem Buch haben müssen. Das Beispiel des Sklaven Young George, der erst ausgepeitscht und dann aufgehängt wird, nur weil er einen Stummel eines Bleistiftes eingesteckt hat, beschreibt in grausamer Weise, was sich damals abspielte.
Je länger James‘ Flucht dauert, desto besser gelingt es ihm, die Überheblichkeit der Weißen gegen sie selbst auszunutzen. Weil die sich nicht vorstellen können, dass Schwarze selbstständig denken und handeln, denn das hat keinen Platz in der Welt der Rassisten. Doch es bleibt immer eine Reise zwischen Angst und Zuversicht.
„James“ ist ein Roman, der tief hineinführt in die Verhältnisse in den Südstaaten. Man liest über die Lebensumstände, über den Alltag, die Denkweise der Menschen, ob schwarz oder weiß und darüber, wie es sich angefühlt haben muss, damals zu leben.
Ein Buch, das wahrhaft einschlägt und niemanden unberührt lassen kann. Es sind die Authentizität der Dialoge und die Abfolge der Ereignisse, die unwiderstehlich einfangen und mitreißen.
Großartig.
Lesenswert.